Radikalisierung auf TikTok: Wie AntiAnti junge Menschen für Desinformation sensibilisiert
von Timon Strnad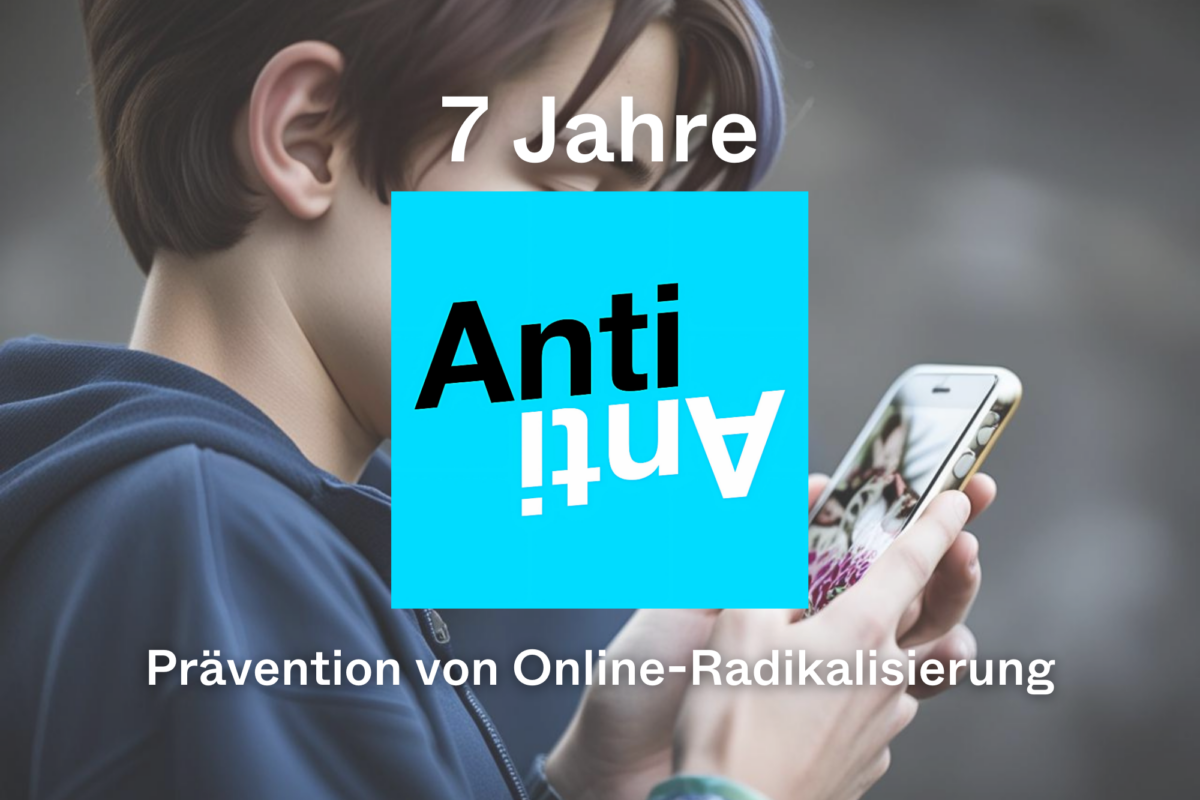
Die Herausforderung: Desinformation und Radikalisierung auf Social Media
Seit 2018 sensibilisiert das Projekt AntiAnti junge Menschen für Desinformation und digitale Radikalisierung. Doch wie hat sich die Herausforderung auf Plattformen wie TikTok verändert? Und welche Methoden haben sich wirklich bewährt? Ein Blick auf sieben Jahre politische Medienbildung – und die Fragen, die jetzt zählen.
Das starke Abschneiden der AfD unter jugendlichen Erstwähler*innen bei den Kommunal- und Europawahlen 2024 war ein Weckruf für die demokratische Zivilgesellschaft. Studien zeigen, dass rechte Akteur*innen gezielt Social Media nutzen, insbesondere TikTok, um antidemokratische und menschenverachtende Inhalte zu verbreiten. Auch das starke Abschneiden der Partei „Die Linke“ bei jungen Erstwähler*innen in der letzten Bundestagswahl – begünstigt durch ihre Präsenz auf Social Media – zeigt, welchen Einfluss politische Inhalte auf diesen Plattformen auf die Meinungsbildung junger Menschen haben. Trotzdem prägen Desinformation, Hate Speech und die subtile Normalisierung von Ungleichwertigkeitsideologien weiterhin die digitale Erfahrungswelt vieler Jugendlicher. Wie kann politische Medienbildung dem entgegenwirken und junge Menschen für demokratische Partizipation auf Social Media begeistern? Seit 2018 bietet das Projekt AntiAnti Workshops an, die genau hier ansetzen: niedrigschwellig, interaktiv und orientiert an den digitalen Lebenswelten junger Menschen. Ziel ist die Prävention von antidemokratischen und menschenverachtenden Radikalisierungsprozessen in den Bereichen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antifeminismus, Verschwörungserzählungen und Islamismus. Neben Jugendlichen richtet sich AntiAnti auch an Lehrkräfte und Sozialarbeiter*innen, um sie im Umgang mit Radikalisierung, Desinformation und Hate Speech zu stärken.
TikTok als Motor für politische Polarisierung
Mit durchschnittlich über 90 Minuten Nutzung pro Tag sind soziale Medien für viele Jugendliche die wichtigste Informationsquelle. Plattformen wie TikTok haben sich längst von reinen Unterhaltungsangeboten zu Nachrichtenkanälen entwickelt. Doch das algorithmische Empfehlungssystem begünstigt provokante Inhalte, während Moderationslücken bestehen bleiben. Studien zeigen, dass bis zu 20 % der Suchergebnisse auf TikTok Falschinformationen enthalten. Rechte Akteur*innen nutzen das gezielt: Sie verpacken radikale Ideologien in harmlos wirkende Lifestyle-Formate oder pseudo-journalistische Videos. Durch ständige Wiederholung werden menschenverachtende Inhalte normalisiert und Jugendliche schleichend in extreme Denkmuster gezogen.
Radikalisierung ist jedoch kein rein digitales Phänomen. Sie entsteht oft im Zusammenspiel mit psychosozialen Faktoren wie Unsicherheit, Einsamkeit oder einem fehlenden Gefühl der Selbstwirksamkeit. Genau hier wird politische Medienbildung wirksam: Junge Menschen müssen darin gestärkt werden, Manipulation zu erkennen, Desinformation zu entlarven und aktiv demokratische Gegenpositionen zu beziehen.
AntiAnti in der Praxis: Methoden für eine kritische Medienkompetenz
Wie kann politische Medienbildung junge Menschen erreichen, ohne belehrend zu wirken? AntiAnti setzt auf aktive Beteiligung, kritische Reflexion und kreative Medienproduktion.
Statt reale Social-Media-Accounts für Analysen zu nutzen – was kaum kontrollierbar wäre – entwickelt AntiAnti analoge und digitale Simulationen von Plattformen. In Workshops analysieren die Jugendlichen echte Beispiele für Desinformation und Hate Speech, die in einem sicheren Rahmen bearbeitet werden können.
Eines der am häufigsten nachgefragten Formate ist dabei der Workshop FAKE?!, der Jugendliche für manipulative Medienstrategien sensibilisiert. Nach einer Analyse realer TikTok-Berichte zu einem Nachrichtenereignis vergleichen sie verschiedene Darstellungsweisen: Wie unterscheiden sich Boulevardmedien, öffentlich-rechtliche Berichterstattung und rechte Meinungsplattformen? Welche Rolle spielen Sprache, Sound und visuelle Effekte?
Im zweiten Schritt produzieren die Teilnehmenden selbst Kurzvideos, in denen sie bewusst manipulative Elemente einsetzen – um die Wirkung von Desinformation zu verstehen. Abschließend werden Handlungsstrategien gegen Desinformation entwickelt: Wie kann ich Falschinformationen entlarven? Welche Argumente helfen in Diskussionen? Wo kann ich selbst aktiv werden?
Herausforderungen und Lösungen: Demokratiebildung unter Druck
Nach sieben Jahren AntiAnti zeigt sich, dass politische Medienbildung mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist. Die Verschiebung des gesellschaftlichen Diskurses nach rechts macht sich auch in Klassenzimmern und Workshops bemerkbar. Offene menschenfeindliche Aussagen oder die Verbreitung von Verschwörungserzählungen sind keine Einzelfälle mehr. Gleichzeitig sind Jugendgruppen häufig heterogen: Während einige selbst von Diskriminierung betroffen sind, nehmen andere diese eher am Rande wahr oder reproduzieren sie sogar – bewusst oder unbewusst.
Daher verfolgt AntiAnti einen wertebasierten Ansatz, der klare Kommunikationsregeln setzt und Jugendliche in der Unterscheidung von Fakten, Meinungen und Hate Speech stärkt. Diskussionen über demokratische Werte sind möglich – aber menschenverachtende Aussagen haben keinen Platz. Besonders wichtig ist dabei, Jugendliche zu stärken, die sich für Demokratie einsetzen, aber im Alltag oft wenig Unterstützung erfahren. Methoden wie argumentatives Training und Strategien gegen Hate Speech helfen, diesen Jugendlichen den Rücken zu stärken.
Fazit: Politische Medienbildung muss strukturell verankert werden
Die wachsende Verbreitung von Desinformation und rechten Inhalten auf Social Media zeigt: Medienpädagogische und demokratiefördernde Bildungsangebote sind notwendiger denn je. Doch sie dürfen nicht nur punktuell stattfinden – nachhaltige Prävention erfordert strukturelle Verankerung. Notwendig sind:
- Soziale Medien als Querschnittsthema in Schulen: Medienbildung muss fester Bestandteil schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit werden.
- Langfristige Kooperationen zwischen Schulen und Bildungsträgern: Demokratieförderung ist nur wirksam, wenn Jugendliche sich kontinuierlich mit den Themen auseinandersetzen.
- Fortbildungen für Lehrkräfte und Sozialarbeiter*innen: Fachkräfte brauchen Werkzeuge, um mit Hate Speech und Radikalisierung im Arbeitsalltag umzugehen.
- Mehr Ressourcen für aktive Medienarbeit: Jugendliche müssen nicht nur aufgeklärt, sondern auch befähigt werden, selbst demokratische Inhalte zu produzieren.
Eine erfolgreiche Präventionsarbeit braucht Zeit, Ressourcen und eine langfristige Perspektive. Denn nur wenn Jugendliche Medienkompetenz entwickeln, Desinformation kritisch hinterfragen und digitale Plattformen bewusst nutzen, kann eine demokratische digitale Öffentlichkeit entstehen.
AntiAnti zeigt, wie politische Medienbildung hier ansetzen kann – und warum sie wichtiger ist als je zuvor.
Wenn ihr an einer Fortbildung oder einem Workshop von AntiAnti interessiert seid, meldet euch über unser Kontaktformular bei uns.



