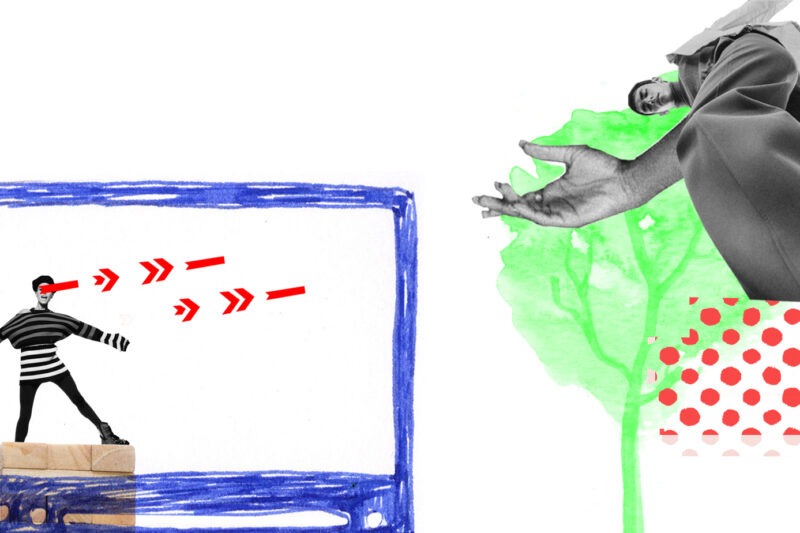Stadt, Land, Faktencheck – Wie Anti Anti Brandenburg Medienkompetenz im ländlichen Raum stärken kann
von Sophie Leubner
Medien prägen, wie junge Menschen die Welt wahrnehmen – ob auf Social Media, in Nachrichten oder durch Diskussionen im eigenen Umfeld. Nicht immer fällt es leicht, zwischen gesicherten Informationen, Meinungen und gezielter Desinformation zu unterscheiden. AntiAnti unterstützt Jugendliche dabei, sich in digitalen Räumen selbstbewusst und kritisch zu bewegen. Seit 2024 gibt es das Projekt auch in Brandenburg – einer Region, in der junge Menschen vor besonderen Herausforderungen stehen. Welche Themen sie beschäftigen und wie politische Bildung nachhaltig wirken kann – ein Gespräch mit Bildungsreferentin Johanna Balsam
Politische Bildung dort, wo Jugendliche sie brauchen
Seit Frühjahr 2024 ist AntiAnti auch in Brandenburg aktiv. Die Erfahrungen zeigen: Junge Menschen haben viele Fragen – zu Medien, zu gesellschaftlichen Debatten, zu ihrer eigenen Zukunft. Gleichzeitig gibt es Herausforderungen, die sie direkt betreffen: Busverbindungen sind eingeschränkt, Jugendclubs und Freizeitangebote stehen oft unter finanziellem Druck, berufliche Perspektiven in der Region sind nicht immer klar.
In digitalen Räumen begegnen Jugendliche täglich einer Vielzahl von Informationen – von journalistischen Berichten über persönliche Meinungen bis hin zu gezielt irreführenden Inhalten. Besonders Beiträge, die Emotionen ansprechen oder einfache Erklärungen für komplexe Themen bieten, werden häufig geteilt und beeinflussen Diskussionen. Während einige Jugendliche gezielt nach verlässlichen Quellen suchen und sich aktiv mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen, sind andere unsicher, welchen Informationen sie vertrauen können, oder haben wenig Anlass, sich mit politischen Themen zu beschäftigen. Oft fehlt es im Schulalltag an Gelegenheiten, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen oder kritische Diskussionen zu führen. Wenn politische Bildung nur punktuell stattfindet, bleibt unklar, welche Bedeutung diese Themen für das eigene Leben haben und wie man sich darin positionieren kann. Politische Medienbildung setzt hier an, indem sie Jugendlichen Werkzeuge an die Hand gibt, um Informationen zu hinterfragen, unterschiedliche Sichtweisen einzuordnen und sich aktiv an gesellschaftlichen Debatten zu beteiligen.
„In vielen Klassen sehen wir, dass rechte Narrative nicht unbedingt tief verwurzelt sind, sondern einfach oft unwidersprochen bleiben – von Mitschüler*innen, leider aber auch von Lehrpersonen. Gleichzeitig gibt es super engagierte Jugendliche, die sich dagegenstellen – aber sie stehen oft alleine da. Wir müssen sie stärker unterstützen.“
Johanna Balsam, Bildungsreferentin AntiAnti Brandenburg
Brandenburg ist aber nicht nur von Herausforderungen geprägt – es gibt zahlreiche junge Menschen, die sich für ihre Anliegen einsetzen, sei es in Jugendorganisationen, lokalen Initiativen oder bei Veranstaltungen wie zum Beispiel den CSDs in Cottbus, Neuruppin oder Brandenburg an der Havel. Sie verdienen Unterstützung, denn ihr Engagement zeigt, dass viele junge Menschen bereit sind, sich mit gesellschaftlichen Themen zu beschäftigen und sich für eine vielfältige Gesellschaft und ein solidarisches Miteinander einzusetzen – on- und offline! Genau hier setzt AntiAnti an.
Learnings aus Brandenburg
Die ersten 20 Workshops in Brandenburg haben gezeigt, dass politische Bildung hier auf andere Herausforderungen trifft als in Berlin. Während in der Großstadt öfter verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen, bleiben in Brandenburg bestimmte Narrative häufiger unwidersprochen. Lehrkräfte berichten, dass rechte Aussagen gezielt zur Provokation genutzt oder durch codierte Begriffe („Dog Whistling“) verschleiert werden.
Manche Jugendliche nutzen Workshops, um ihre Positionen offensiv zu vertreten, während andere sich eher raushalten – nicht unbedingt, weil sie zustimmen, sondern weil sie unsicher sind. “In einer Klasse war die Atmosphäre zunächst ruhig, doch am Ende tauchte auf den iPads ein Meme auf, das einen Mitschüler mit Migrationsgeschichte diffamierte. Gleichzeitig gibt es viele engagierte Jugendliche, die sich für demokratische Werte einsetzen, sich dabei aber oft allein fühlen.”, so Johanna Balsam. “Einige berichten, dass sie online angegriffen werden, wenn sie sich für queere Rechte starkmachen.” Diese Erfahrungen zeigen, dass Workshops nicht nur Desinformation entlarven, sondern auch diejenigen unterstützen müssen, die sich bereits für eine offene Debattenkultur einsetzen. Außerdem wird immer deutlicher: Politische Bildung muss früher ansetzen, bevor sich menschenverachtende Weltbilder verfestigen und es zu Situationen von Mobbing, Diskriminierung oder der Verbreitung von Hetze kommt. Dafür hat AntiAnti nun ein Workshopkonzept zu Desinformation und Medienkompetenz ab der 7. Klasse entwickelt.
Mehr als einmalige Workshops: Politische Bildung braucht Struktur
In den Workshops geht es nicht darum, Jugendlichen eine bestimmte Sichtweise zu vermitteln. Vielmehr sollen sie ermutigt werden, selbst Fragen zu stellen, Informationen einzuordnen und gesellschaftliche Debatten aktiv mitzugestalten. Gerade Themen, die ihren Alltag direkt betreffen – wie Ausbildungschancen, Infrastruktur oder lokale Politik – sind oft ein guter Ausgangspunkt für Diskussionen. Politische Bildung sollte dort ansetzen, wo junge Menschen ohnehin schon Fragen haben – und sie dabei unterstützen, eigene Antworten zu finden, auch wenn ihr Umfeld nicht immer offen für Diskussionen ist.
„Wir erleben immer wieder, dass Schulen uns erst anfragen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Dann gab es eine Eskalation, irgendwas ist vorgefallen – aber politische Medienbildung muss viel früher ansetzen, bevor sich bestimmte Meinungsbilder verfestigen – und eigentlich schon, bevor Jugendliche auf Social Media Plattformen mit Hass, Hetze und Desinformation konfrontiert sind.“
Johanna Balsam, Bildungsreferentin
Teamer*innen des Projekts berichten außerdem des Öfteren, dass auch Lehrkräfte oder Eltern antidemokratische und menschenverachtende Haltungen vertreten und Gegenrede dadurch wenig Rückhalt findet. Dem zu begegnen ist eine Aufgabe für die gesamte Schule.
Daher sind langfristige Strukturen, die Schulen dabei unterstützen, politische Bildung und Partizipation nachhaltig zu verankern, besonders wichtig. Dazu gehört nicht nur die Arbeit mit Jugendlichen, sondern auch die Begleitung von Lehrkräften und Schulsozialarbeiter*innen. Auch hier bietet AntiAnti regelmäßig Fortbildungen an, die Lehrer*innen dabei helfen, sich mit politischen und medialen Dynamiken auseinanderzusetzen und konstruktive Diskussionen im Schulalltag zu fördern.
Fazit: Jugendliche stärken, langfristige Perspektiven schaffen
Brandenburg ist vielfältig – mit engagierten Jugendlichen, die sich für ihre Zukunft interessieren und eine demokratische Gesellschaft aktiv mitgestalten wollen. Sie verdienen Räume, in denen sie sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen können. Politische Bildung darf nicht nur reagieren, sondern sollte langfristig wirken und diejenigen stärken, die bereits Haltung zeigen, sowohl im Klassen- als auch im Lehrer*innenzimmer.
Mehr Infos zum Projekt gibt es hier: wirsindantianti.org/brandenburg
Was kannst du tun, um eine demokratische Medienkultur im ländlichen Raum zu stärken?
- Den Artikel teilen, um mehr Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen
- Ein Angebot anfragen, wenn du politische Medienbildung an deine Schule oder deinen Jugendclub holen willst
- Uns kontaktieren, wenn du selbst Ideen hast oder Unterstützung suchst
Die Arbeit von AntiAnti Brandenburg wird gefördert durch das Ministerium für Jugend, Bildung und Sport des Landes Brandenburg und unterstützt von der Medienanstalt Berlin Brandenburg.
Weiterführende Links:
https://www.opferperspektive.de/materialien/publikationen/rechte-gewalt-kontext-schule
https://www.wochenschau-verlag.de/Politische-Bildung-in-reaktionaeren-Zeiten/41136