Prävention statt Reaktion: Früher ansetzen gegen Fake News und Desinformation
von Serkan Ünsal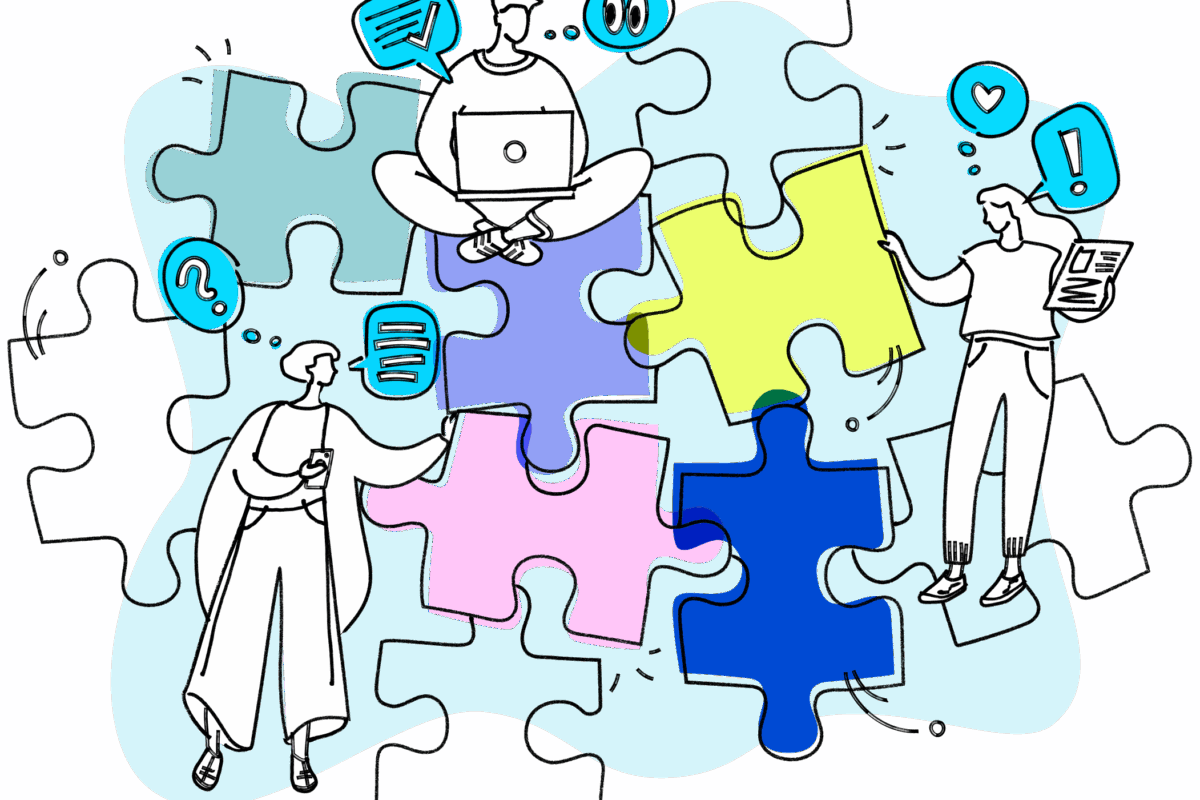
In unseren AntiAnti-Workshops arbeiten wir seit 2018 erfolgreich mit Jugendlichen ab 14 Jahren. Dabei wird uns zunehmend klarer: Um Medien- und Informationskompetenz nachhaltig zu stärken, sollten wir bereits früher ansetzen, um präventive Bildung in jüngeren Jahren möglichst wirksam zu gestalten. Aus dieser Erkenntnis ist unsere neue Open Educational Resource „FAKT oder FAKE?“ für die 7. und 8. Klasse entstanden.
Früher ansetzen für bessere Prävention
In der ersten Hälfte des Jahres 2024 haben wir in unserer Arbeit in Berlin und Brandenburg eine wichtige Erkenntnis gewonnen: Unsere bisherigen AntiAnti-Workshops richten sich an die Altersgruppe ab 14 Jahren und schaffen damit ein wichtiges Angebot, das von vielen Schulen gebucht wird. Gleichzeitig wird immer klarer, dass der Bedarf nach niedrigschwelligeren und früher ansetzenden Workshops sehr hoch ist.
Daher haben wir uns entschieden, ein Methodenset als Open Educational Resource (OER) zum Themenkomplex Fake News und Desinformation zu entwickeln, das auf jüngere Zielgruppen in der Altersgruppe 12 bis 14-Jähriger ausgerichtet ist. In den Klassenstufen 7 und 8 formieren sich Klassenverbände neu, so dass wir uns einen Zugang jenseits bereits manifestierter Gruppendynamiken erhoffen. Zudem beginnen in diesem Lebensabschnitt viele Jugendliche ihre Weltbilder zu festigen, Grenzen werden ausgetestet und neue Perspektiven entwickelt.
Gleichzeitig stecken viele in diesem Alter in der Anfangsphase ihrer Nutzung sozialer Medien. Das bedeutet: Statt zu warten, bis sich Nutzungsmuster verfestigen und problematische Inhalte teils unreflektiert konsumiert werden, setzen wir auf eine frühere Stärkung von Informationskompetenz.
Wie Plattformlogiken Desinformation verstärken
Die Mechanismen von Plattformen wie TikTok verstärken das Problem systematisch: Algorithmen bevorzugen sensationelle Inhalte, die schnelllebige Content-Kultur fragmentiert komplexe politische Themen in kurze Häppchen, und wichtige Kontexte gehen dabei verloren. Rechte Akteur*innen nutzen das gezielt, indem sie menschenverachtende Ideologien in harmlos wirkende Lifestyle-Formate verpacken oder pseudo-journalistische Videos produzieren.
Nicht nur in Berlin, auch in Brandenburg haben wir das beobachtet: Es werden regelmäßig AfD-nahe Inhalte konsumiert, ohne zu merken, dass es sich um gezielte politische Propaganda handelt. Die Shell Jugendstudie 2024 bestätigt zudem, dass Jugendliche selbst einen starken Wunsch nach mehr Information und Orientierung zu sozialen Medien äußern.
Früher ansetzen – aber wie?
Unsere Antwort ist ein methodischer Ansatz, der direkt an der Lebensrealität von 12- bis 14-Jährigen ansetzt. Statt über TikTok zu schimpfen, machen wir es zum Gegenstand kritischer Analyse und kreativer Aneignung. Mit „FAKT oder FAKE? – Desinformation entschlüsseln, den Durchblick behalten“ haben wir ein Methodenset als OER entwickelt, das auf drei Säulen fußt:
Wir nutzen Methoden der aktiven Medienarbeit und behandeln Jugendliche als Expert*innen ihrer digitalen Lebenswelten. Statt belehrend zu agieren, analysieren wir gemeinsam, wie Plattformmechanismen funktionieren, warum Algorithmen sensationelle Inhalte bevorzugen oder wie Nudging in Apps das Nutzungs- und Konsumverhalten beeinflusst.
Kernelement der Wissensvermittlung ist, warum Desinformation und Manipulation als Phänomene gefährlich für unsere Demokratie sind. Desinformation beeinflusst konkret das Wahlverhalten, spaltet und kann zu realer Gewalt führen. Besonders Gruppen werden gefährdert, die ohnehin von Diskriminierung betroffen sind. Es geht also nicht nur um unterschiedliche Meinungen, sondern um den bewussten Missbrauch von Informationen als Machtmittel.
Jugendliche verstehen dabei auch die Rolle von Medien in der Gesellschaft: Warum gibt es journalistische Standards und einen Pressekodex? Was bedeutet False Balance? Wie unterscheiden sich Redaktionen mit Faktenchecks und Quellenprüfungen von oft ungefilterten Meinungsäußerungen auf Social Media? Diese Fragen sind für die Zielgruppe zugänglich, wenn sie konkret an ihren eigenen Medienerfahrungen ansetzen. Dabei vertrauen wir darauf, dass Jugendliche in der Phase der Neuorientierung eigene kritische Urteile entwickeln können, wenn sie die richtigen Werkzeuge bekommen.
Wie wir mit 13-Jährigen Desinformation auf TikTok entschlüsseln
Unser methodischer Kern setzt direkt dort an, wo sich die Lebenswelt der Jugendlichen abspielt: auf TikTok. Die Jugendlichen schauen sich zunächst ausgewählte Videos zu einem relevanten Klimaereignis an – mal von den Öffentlich-Rechtlichen, mal von einer Influencer*in, und immer aus unterschiedlichen Perspektiven. Dabei merken sie schnell: Es ist dasselbe Ereignis, aber die Stimmung, die Botschaft und die „Fakten“ sind teilweise sehr unterschiedlich.
Mit Symbolkarten können sie dann benennen, was sie instinktiv spüren: Hier wird Angst geschürt, dort wird polarisiert, da werden Informationen aus dem Zusammenhang gerissen. Diese Analysephase macht bewusst, was sonst teils unbewusst beim Scrollen passiert.
Im nächsten Schritt sind die Teilnehmenden selbst dran: Sie produzieren Videos zu einem erfundenen Schulereignis: Ein 3D-Drucker für die Cafeteria: Soll gut für die Umwelt sein, aber es gibt auch Kritik!
Die Video werden in unterschiedlichen Medienrollen produziert. Dabei erleben sie hautnah, wie einfach es ist, durch Musik, Schnitt und Wortwahl sich stark unterscheidende Stimmungen zu erzeugen, obwohl auf den ersten Blick alle über dasselbe berichten.
Die Resonanz der Jugendlichen auf die Methoden fällt bisher sehr gut aus: Wenn sie selbst erleben, wie einfach es ist, durch dramatische Musik, emotionale Sprache oder das Weglassen wichtiger Informationen zu manipulieren, können sie ein neues Bewusstsein für die Mechanismen von Desinformation entwickeln. Sie beginnen kritische Konsument*innen zu werden.
Warum wir auf OERs setzen
Die Herausforderung ist real: Während rechte Akteur*innen Millionen in professionelle Social-Media-Strategien investieren, müssen Bildungsakteur*innen auf Zusammenarbeit und das Teilen ihrer Ressourcen setzen. Denn eine gute Methode nutzt niemandem, wenn sie im Workshopraum bleibt.
Deshalb haben wir „FAKT oder FAKE?“ als Open Educational Resource entwickelt. Das komplette Methodenset umfasst alle nötigen Materialien, und Methoden können auch einzeln in Lernsituationen integriert werden. Präsentationen, Arbeitsblätter, Symbolkarten und Anleitungen stehen unter CC BY 4.0-Lizenz kostenfrei zur Verfügung.
Wir arbeiten bereits an Erweiterungen, sammeln Feedback aus der Praxis und entwickeln neue Ansätze. Demokratiebildung ist nie abgeschlossen, sie muss sich ständig den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen anpassen. Nur wenn wir Jugendliche früh dabei unterstützen, Medienkompetenz zu entwickeln und kritisch zu hinterfragen, können digitale Räume demokratischer werden.
Habt ihr Lust, die Methoden auszuprobieren? Alle Materialien findet ihr hier. Wir freuen uns über euer Feedback! Meldet euch gerne bei uns, nutzt die Methoden und teilt eure Erfahrungen.
Die Illustration ist der OER „FAKT oder FAKE?“ entnommen und gestaltet von Andrea Ida




