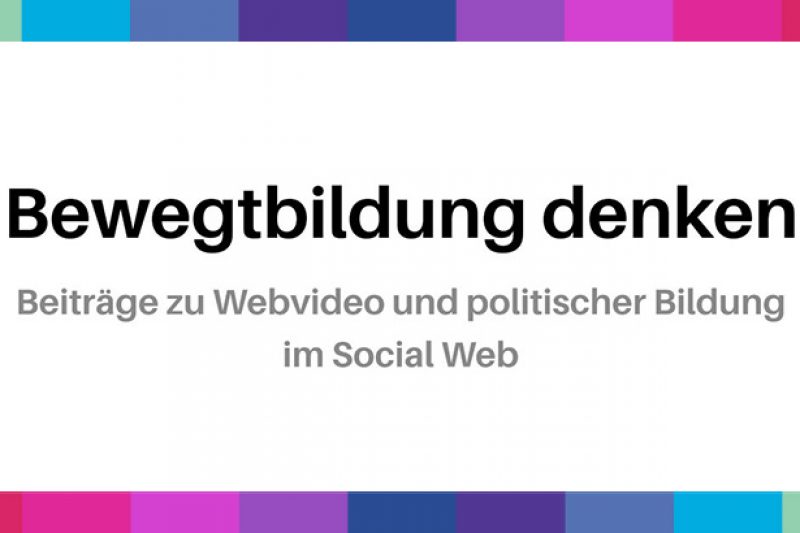Vernetzt euch! Politische Bildungsarbeit in Zeiten rechter Normalisierung
von Henrike Tipkaemper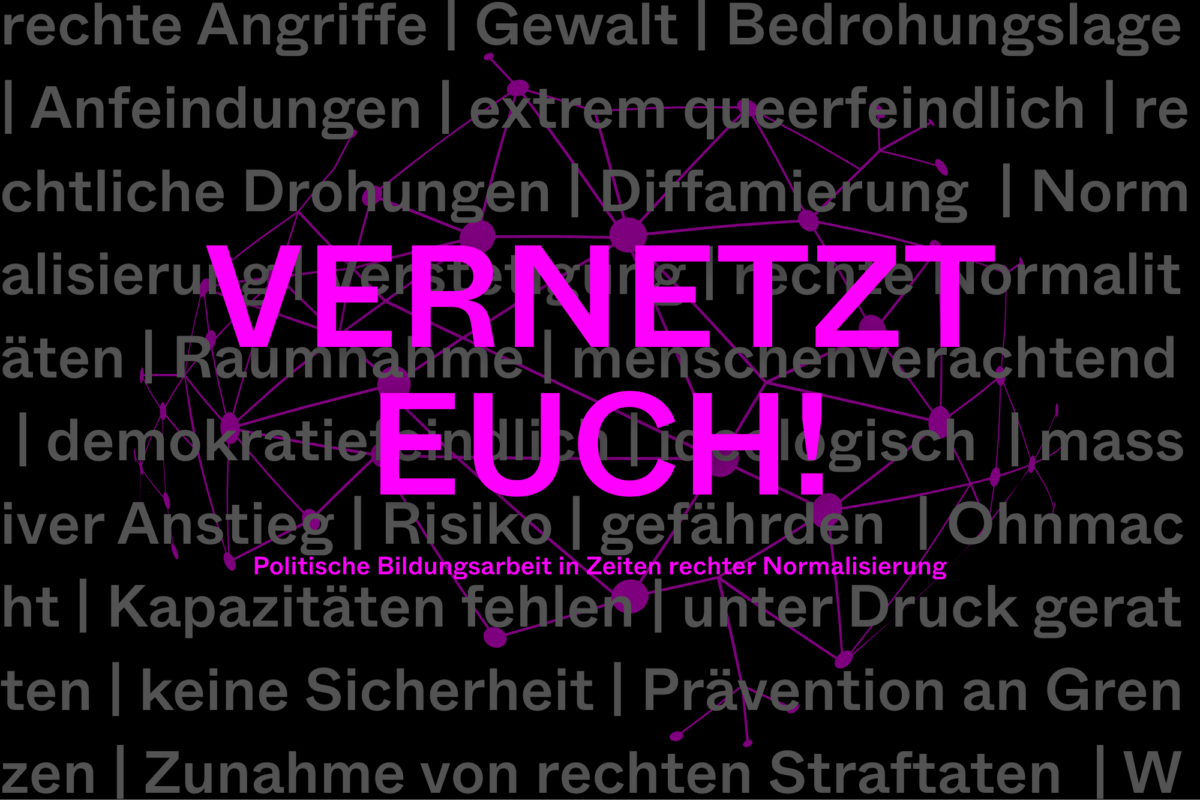
Rechtsmotivierte Straftaten haben 2024 massiv zugenommen – ein Trend, der seit Jahren anhält. In manchen Regionen ist ein demokratisches Aufwachsen für viele Jugendliche nicht mehr gegeben. Welche Herausforderungen entstehen dadurch für die politische Bildungsarbeit? Wo stoßen primärpräventive Ansätze an ihre Grenzen und was braucht es, um als Trägerlandschaft der politischen Bildungsarbeit gemeinsam handlungsfähig zu bleiben?
Herausforderungen der Bildungsarbeit in zunehmend rechteren Zeiten
Dass die Normalisierung und Verstetigung reaktionärer bis neonazistischer Ideologien in großen Teilen der Bevölkerung verbreitet ist, ist spätestens seit der Bundestagswahl 2025 klar: die AfD, als eine in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei, erlangte bundesweit 20,8% der Zweitstimmen, was eine Verdopplung der Wahlergebnisse 2021 darstellt. Dies wird auch mit Blick auf die Statistiken zu rechter, rassistischer und antisemitisch motivierter Gewalt deutlich: im Jahr 2024 ereigneten sich täglich mindestens neun rechte Angriffe in Deutschland, was ein Anstieg von über 20 Prozent zum Vorjahr ist. Dabei werden die Ausübenden rechts-motiverter Strafttaten immer jünger und sind oftmals jünger als 14 Jahre. Im Kontext Schule wird dies unter anderem durch rechtsextreme Äußerungen oder Symbole von Schüler*innen in Schulklassen deutlich, aber auch durch die vermehrte Bedrohungslage für Betroffene, also Menschen, die nicht in ein rechtes Weltbild passen. Anfragen von Lehrkräften und Schulsozialarbeiter*innen die uns bei AntiAnti erreichen zeigen: rechte Normalitäten sind real und sie haben Folgen. In manchen Regionen müssen sich pädagogische Fachkräfte täglich der Aufgabe stellen, menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Äußerungen angemessen zu begegnen, Betroffene zu schützen und gleichzeitig im Kontext Schule in einem konstruktiven Dialog zu bleiben. Hierfür reichen die gegebenen Ressourcen oft nicht aus, weshalb sich beispielsweise an das Projekt AntiAnti als einen externen Träger der Radikalisierungsprävention gewandt wird.
In anhaltenden Zeiten zunehmend rechter Normalitäten gerät aber auch die politische Präventionsarbeit in den Klassenzimmern, Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen unter Druck. Die Fachstelle Rechtsextremismusprävention (fa:rp) stellte bereits 2023 fest: “Demokratie unter Druck? Rechtsextremismusprävention unter Druck”.
Wenn Workshops zum Risiko für Teamende und Teilnehmende werden
„Ich bin froh, wenn ein Workshop vorbei und ohne Zwischenfälle gelaufen ist“
Teamer*in AntiAnti
„Ich bin froh, wenn ein Workshop vorbei und ohne Zwischenfälle gelaufen ist“ – dieses Zitat einer Kollegin bringt die aktuelle Realität auf den Punkt. Im Austausch mit anderen Akteur*innen wird deutlich: Je nach regionalen Bedingungen ist ein demokratisches, menschenrechtsorientiertes Aufwachsen für viele Jugendliche nicht mehr gegeben. Nicht rechts orientierte Jugendliche können oft nicht mehr sicher aufwachsen, sie werden bedroht und angefeindet.
Auch in Workshopkontexten wird eine Zunahme rechter Normalitäten deutlich. So müssen wir uns während unserer Workshoporganisation fragen, wie wir damit umgehen, wenn ein demokratischer Grundkonsens in Schulen, an denen beispielsweise 75% bei der U18-Wahl für die AfD gestimmt haben, nicht mehr gegeben ist oder Workshops wie „Viral Hate – Strategien der extremen Rechten Online“ bereits durch ihren Titel Widerstand und Provokation auf Seiten rechtsaffiner Jugendlicher auslösen. Erfahrungen vergangener Workshops zeigen: rechte Raumnahme wird im Kontext unserer Bildungsarbeit spürbar. So wurde beispielsweise in einem Workshop vor den Sommerferien ein Hitlergruß auf einem selbst produzierten Kurzvideo angedeutet. In einem anderen Workshop kam es zu queerfeindlichen Anfeindungen gegenüber Teamenden durch Schüler*innen. Im Nachgang dieses Workshops erreichten uns und die Schule extrem queerfeindliche E-Mails und die Androhung eines rechtlichen Verfahrens gegen uns von Seiten der Erziehungsberechtigten einer Schülerin.
„Sie sind an einer Oberschule in Brandenburg – was denken Sie?“
Lehrer*in im Vorgespräch auf die Nachfrage nach rechten Vorfällen in der Klasse
Diese Erfahrungen zeigen, dass politische Bildungsarbeit zum Risiko für Schüler*innen, Teamende und unseren Verein werden kann. So stehen wir als Verein vermehrt vor folgenden Fragen: Wie können wir als externe Träger Jugendliche, die sich gegen rechte Äußerungen positionieren oder von rechter Gewalt betroffen sind, schützen? Was muss gewährleistet sein, damit wir durch unseren Ansatz der Kurzzeitpädagogik diese Jugendlichen nicht gefährden? Bis zu welchem Grad führen wir Workshops durch? Unsere oberste Prämisse: Wir machen nur soweit Workshops, wie wir den Schutz unserer Teamenden gewährleisten können. Doch oft werden wir belächelt, wenn wir bei Vorgesprächen nachfragen, ob rechte Vorfälle in der Klasse bekannt sind. Die Antwort: „Sie sind an einer Oberschule in Brandenburg – was denken Sie?“
Wenn Prävention an Grenzen stößt
Bei AntiAnti arbeiten wir mit einem universellen Präventionsansatz: Wir möchten prinzipiell alle Teilnehmer*innen unserer Angebote erreichen. Gleichzeitig ist unser Ansatz primärpräventiv ausgelegt – das heißt, unsere Workshopprogramme sind vorbeugende Maßnahmen und richten sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14-21 Jahren, die keine radikalisierten Weltbilder haben und erreichen diese vor allem in Schulen aber auch in Jugend-und Freizeiteinrichtungen. Ziel unserer Workshops ist es vor allem in den Austausch zu kommen und Jugendlichen zu ermöglichen, rechte Narrative zu erkennen und zu entschlüsseln, sowie Jugendliche darin zu stärken, sich gegen menschenverachtende und rechte Einstellungen zur Wehr zu setzen.
Doch es häufen sich Anfragen von Schulsozialarbeiter*innen und Lehrkräften, die konkret rechten Normalitäten und diskriminierenden Vorfällen an ihren Schulen etwas entgegensetzen wollen. Hier bräuchte es eigentlich sekundärpräventive Ansätze im Sinne von anlassbezogenen Interventionsmaßnahmen oder Distanzierungsarbeit. Aber: Sind eintägige Workshops dafür geeignet? Distanzierungsarbeit braucht langfristige Beziehungsarbeit. Hier fehlen oft die Kapazitäten – nicht nur uns, sondern auch vor Ort. Grundsätzlich zeigt sich, dass Präventionsarbeit früher ansetzen muss, weswegen wir im Prozess sind unsere Bildungsangebote auf jüngere Zielgruppen zu erweitern (hierzu auch spannend: Blogbeitrag “Prävention statt Reaktion: Früher ansetzen gegen FakeNews und Desinformationen”).
Strukturelle Veränderungen und politische Konsequenzen notwendig
Als Trägerlandschaft der politischen Bildungsarbeit können wir die gesamtgesellschaftliche Lage nicht ändern. Wir passen unsere Konzepte an und tragen dazu bei, demokratische Denkmuster zu stärken – doch entscheidend ist die politische Verantwortung. Es braucht strukturelle Veränderungen und klare Konsequenzen: langfristige Förderstrukturen für politische Bildungsarbeit, Unterstützung für lokalpolitische und zivilgesellschaftliche Akteur*innen, finanzielle Ausstattung von Betroffenen- und Beratungsstellen sowie verbindliche Maßnahmen gegen rechte Akteur*innen – auch an Schulen.
Strategien zum Durchhalten
Wie können wir in diesen herausfordernden Zeiten als Träger der politischen primärpräventiven Arbeit handlungsfähig bleiben?
Wie vorher beschrieben, sind strukturelle Veränderungen und politische Konsequenzen dafür zentral. Gleichzeitig braucht es Strategien, mit denen wir unsere Arbeit auch im Alltag absichern und fortsetzen können.
1. Weiterbildung und Vernetzung
Regelmäßiger Austausch mit anderen Bildungsträgern sowie mit lokalen Akteurinnen wie Schulen, Jugendclubs und Schulsozialarbeit ist wesentlich. Nur so lassen sich regionale Gegebenheiten realistisch einschätzen und Strategien für verschiedene Szenarien entwickeln. Ein Beispiel war die Fortbildung „“Stabil bleiben – eine Praxiswerkstatt zur Auseinandersetzung mit demokratie-und menschenfeindlichen Haltungen in der Jugend(sozial)arbeit” von Cultures Interactive, bei der Akteurinnen aus Schulsozialarbeit, Jugendfreizeiteinrichtungen und Bildungspraxis ihre Erfahrungen geteilt haben.
2. Be prepared – Vorbereitung auf Störungen
Gezielte Provokationen und Störungen sind eine Strategie rechter Akteur*innen. Vorbereitung hilft: etwa durch Argumentations- und Handlungstrainings gegen Rechts, wie sie das Netzwerk für Demokratie und Courage anbietet, durch Übungen für Erstreaktionen bei verbaler rechter Raumnahme oder durch Maßnahmen zur Selbstfürsorge und zum Schutz der Teamenden.
3. Dokumentation von Vorfällen
Die systematische Dokumentation rechter und diskriminierender Vorfälle ist entscheidend – sowohl zur Meldung an Schulämter, das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) oder Beratungsstellen, als auch zur eigenen Absicherung bei rechtlichen Drohungen. Wichtig ist, diskriminierende Vorfälle im schulischen wie im außerschulischen Kontext sorgfältig zu erfassen und so die eigene pädagogische Professionalität zu belegen.
4. Umgang mit Druck von außen
Auch Eltern oder Bezugspersonen üben zunehmend strategischen Druck aus. Standardisierte Antwortschreiben, interne Leitfäden und klare Eskalationswege helfen, professionell zu reagieren und sich nicht einschüchtern zu lassen.
5. Solidarisches Framing statt Konkurrenz
Die Herausforderung ist real: Während rechte Akteur*innen Millionen in professionelle Social-Media-Strategien investieren, müssen Bildungsakteur*innen auf Zusammenarbeit und das Teilen ihrer Ressourcen setzen. Wir bei mediale pfade verfolgen mit unserem OER-Ansatz das Prinzip „public money – public good“. Offene Bildungsressourcen bedeuten nicht nur geteiltes Wissen, sondern auch gemeinsame Verantwortung und Solidarität in herausfordernden Zeiten.
Hier zeigt sich die unbedingte Notwendigkeit der Vernetzung – mit lokalen Trägern vor Ort ebenso wie zwischen externen Bildungsträgern. Dafür braucht es bessere Fahrpläne für unterschiedliche Workshopszenarien, die über interne Strukturen hinausreichen.
Gemeinsam stark bleiben – Vernetzung statt Einzelkampf
Deshalb laden wir euch zu unserem ersten Vernetzungstreffen am 8. Oktober von 14:00 bis 16:00 Uhr ein – in Präsenz in Berlin Kreuzberg oder online. Wir wollen gemeinsam in den Austausch zum Umgang mit menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Äußerungen in der außerschulischen Bildungsarbeit kommen.
Wir freuen uns auf solidarische Vernetzung und das Teilen unterschiedlichster Strategien. Anmeldungen gerne per Mail an .
In diesem Sinne: Bleibt stabil und solidarisch! Wir sehen uns hoffentlich im Oktober.
Oder kontaktiert uns auf folgenden Kanälen:
Mail an oder Mastodon, Bluesky, Instagram, Linkedin